Das Wärmepumpen Testzentrum hat eine kurze Studie veröffentlicht, in der der Einfluss der Spreizung auf den COP untersucht wurde. Die Resultate sind ähnlich wie auf dieser Seite für die Solespreizung gerechnet wurde.
Die Studie kommt zum Ergebnis, dass unter den untersuchten Bedingungen eine Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe von 10 K ideal ist. Die Aussagen beziehen sich auf das Kältemittel R407c. Bei Spreizungen unterhalb 5 K bricht der COP vergleichsweise stark ein, auch ohne Einbezug der Umwälzpumpen. Dieses Verhalten ist auf das Gleit des R407c zurückzuführen. Mit Einbezug der Umwälzpumpe ist eine Spreizung von 5 K leicht schlechter als bei 10 K, obwohl der COP des Verdichters besser ist. Die COP Abnahme unter 5 K ist noch deutlicher. In der Studie wurde aber offensichtlich nur der Anteil des Druckverlusts im Verflüssiger berücksichtigt, den die Pumpe überwinden muss. Wird der gesamte Druckverlust des Heizsystems berücksichtigt, verschiebt sich das Optimum weiter Richtung grösserer Spreizung.
Der ideale Arbeitspunkt ist jedoch von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Einerseits ist der Einfluss der Heizkreispumpe ein gewichtiger Faktor. Bei leistungsstarken Umwälzpumpen liegt das Optimum bei höheren Spreizungen als bei kleinen, effizienten Pumpen. Ebenso hat das Kältemittel einen Einfluss. Vor allem bei Kältemitteln ohne Gleit wie etwa R134a dürfte die Situation bei Spreizungen < 5 K deutlich anders aussehen.
Wie in Abb. 1 zu sehen, ist die Kondensationstemperatur bei R407c nicht konstant (Gleit). (In der entsprechenden Grafik im Bericht des WPZ ist dies falsch eingezeichnet, ebenso wie die Bezeichnung «Länge des Kondensators» die die Enthalpie sein sollte.) Steigt nun die Rücklauftemperatur an, sinkt die Unterkühlung und die Kondensationstemperatur steigt, da ansonsten die Heizwassertemperatur über die Endtemperatur der Kondensation zu liegen käme (was nicht sein kann). Beides verschlechtert den COP. Die optimale Spreizung liegt vermutlich im Bereich des Gleits. Im idealen Wärmetauscher (unendliche Fläche) wäre die Heizmitteltemperatur gleich der mittleren Kondensationstemperatur (ohne Berücksichtigung der Enthitzung). Die Kurven Heizkreis (rot) und Kältemittel (blau) lägen im Bereich der Kondensation übereinander (Abb. 1c). Sinkt die Spreizung gegen 0, d.h. die rote Kurve wäre waagrecht und die mittlere Kondensationstemperatur liegt im besten Fall um den halben Gleit höher als die mittlere Heizkreistemperatur. Die Endtemperatur der Kondensation ist hier der bestimmende Punkt. Bei höherer Spreizung als der Gleit wird hingegen die Anfangstemperatur der Kondensation (Taupunkt) die bestimmende Grösse die die Kondensationstemperatur nach oben drückt.
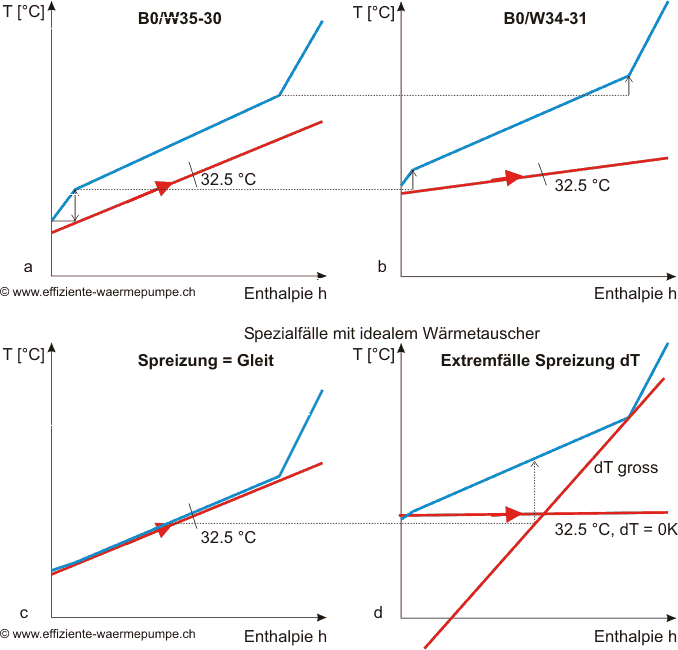

1. So falsch finde ich die Darstellung vom WPZ über die Länge des Kondensators nicht, schließlich nimmt die Enthalpie des Wassers mit fortschreitender Kondensation zu und die Enthalpie des Kältemittels nimmt ab. Streng genommen ist also ihre Darstellung nicht korrekt.
2. Die rote waagrechte Linie in Bild d sollte auf Höhe der Hilfslinie verlaufen, da sonst keine Vergleichbarkeit gegeben ist und zudem keine Unterkühlung auftritt.
Die Enthalpie von flüssigem Wasser ist proportional zu dessen Temperatur. Die T-h Kurve von Wasser ist also eine Gerade wie in obigen Diagrammen. Gleiches gilt für das Kältemittel in den jeweiligen Phasen.
Das WPZ stellt die Kurven in einem T-L Diagramm dar, mit L = Länge des Kondensators. Die Kurven werden als Geraden dargestellt. Dies ist dann korrekt, wenn die Enthalpie proportional zur Länge des Kondensators ist. Dies setzt voraus, dass der Wärmestrom durch den Kondensator über die gesamte Länge konstant ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Einerseits sind die Temperaturunterschiede zwischen Kältemittel und Wasser über die Länge unterschiedlich, andererseits sind die Wärmeübergänge auf der Kältemittelseite je nach Phase sehr unterschiedlich. Der Wärmeübergang bei der Kondensation z.B. ist grösser als bei der Enthitzung. Daher ist die Darstellung mit Geraden im T-L Diagramm nicht korrekt.